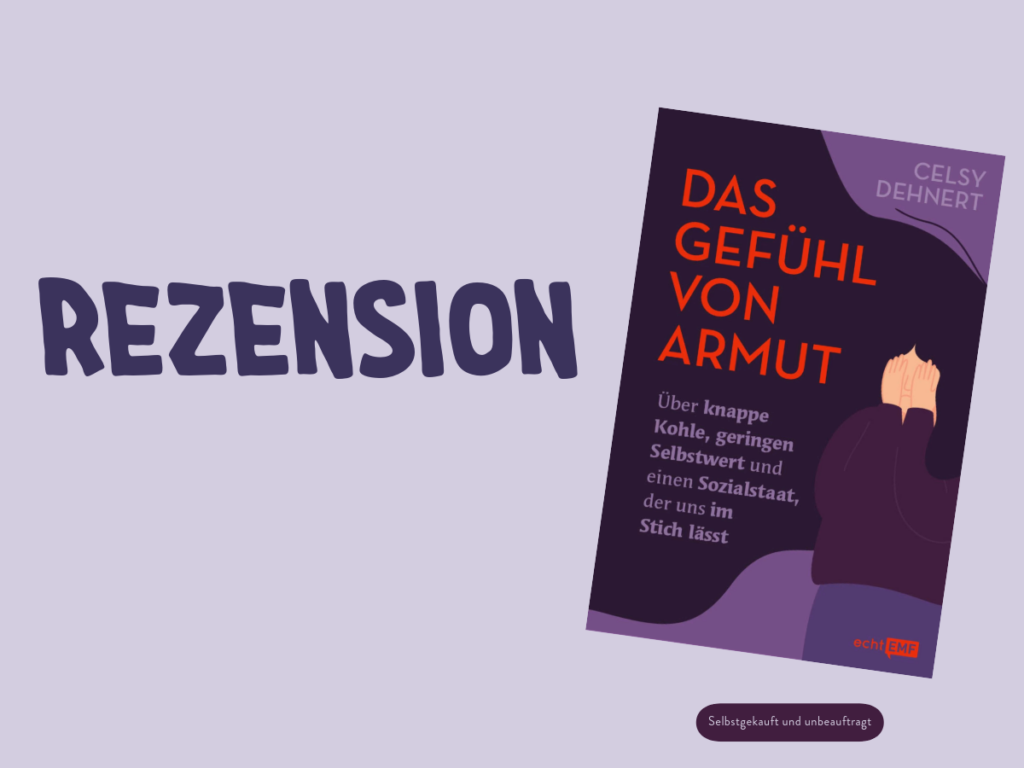Du fragst dich vielleicht: Was genau macht eine Rezension über ein Buch, das auf den ersten Blick so gar nichts mit Ernährung oder Entspannung zu tun hat, auf diesem Blog? Ich sag es dir: aus diesem Buch kann ich eine Menge für meine Arbeit mitnehmen – und deswegen ist die Zielgruppe für diesen Blogbeitrag der Kreis meiner Kolleg*innen. Und wir steigen direkt ein: Was ist denn das Gefühl von Armut?
Das Gefühl von Armut: Scham
Für mich ist nach der Lektüre insbesondere eins hängen geblieben: die Scham, die Armutsbetroffene so oft fühlen. Scham auf so vielen Ebenen, es ist erschreckend. Und mit wirklich geschickt gewählten Beispielen aus Alltagssituationen wird dieses Gefühl bebildert und den Lesenden näher gebracht.

Und das ist es auch, was dieses Buch in meinen Augen so besonders wertvoll macht. Denn Statistiken zum Thema Armut können wir uns alle anschauen. Aber die Erfahrungen können nur Betroffene teilen und das geschieht in diesem Buch in starken Bildern. Passender könnte der Titel also kaum sein.
Besonders eindrücklich war für mich vor allem, wie lange und in welcher Form die Armut noch nachwirkt. Also selbst dann, wenn eine Person nicht mehr von Armut bedroht ist, ziehen sich gelernte Muster noch viele Jahrzehnte durchs Leben. Sie führen zu einem erheblichen Mehr an Mental Load und Stress, den sich Menschen ohne die entsprechenden Erfahrungen nur schwer vorstellen können. Und dieses „Mehr“ werden wir ganz sicher nicht von Klient*innen und Patient*innen auf dem Silbertablett serviert bekommen. Es ist daher meiner Meinung nach im Aufgabenbereich der beratenden Person eine Atmosphäre zu schaffen in der diese Scham nicht wieder im Vordergrund steht. Denn dann steht sie auch im Weg zu einer vertrauensvollen Beziehung – die ja nun mal die Basis sein sollte.
Ganz wichtig ist mir gleichzeitig noch zu sagen: es ist eben mehr als ein reiner Erfahrungsbericht. Diese Erfahrungen werden in das gesellschaftliche Gesamtbild eingeordnet. Mit Studienverweisen, Gesetzestexten oder auch politischen Anekdoten.
Geld und Ernährung
Über ein Viertel des Kapitels „Konsum“ handelt davon, wie Geld die Ernährung und das Essverhalten beeinflusst. Ich finde es wenig verwunderlich, da sich bei uns allen vieles ums Essen dreht. Es kann Genuss sein, es kann ein soziales Highlight sein, es kann aber auch Stress auslösen oder gar eine Last darstellen. Dass ein gesundheitsfördernder Lebensstil und die Gesundheit maßgeblich vom Geldbeutel abhängen ist hoffentlich kein Geheimnis mehr unter meinen Kolleg*innen (auch wenn gerade die, die die Wunderprodukte und -maßnahmen verkaufen, das ganz anders darstellen).
Ich gebe ehrlich zu, ich rolle innerlich gerne mit den Augen, wenn mir jemand erzählt, dass Gemüse bio sein muss, Fertiggerichte per se schlecht sind und Tiefkühlkost sowie Konserven quasi aus dem Vorhof der Hölle entspringen. Nicht zu vergessen, dass das Mehl erst unmittelbar vor Verwendung gemahlen werden sollte, die meisten Zutaten aus dem eigenen Garten kommen sollten und diverse Gemüsesorten einen mehrschnittigen, zeitaufwendigen Prozess durchlaufen müssen um maximal verträglich zu sein und die Nährstoffaufnahme zu maximieren. Ich hoffe die Übertreibungen waren deutlich genug.

Welch Privileg es ist, bei diesen Aussagen einfach nur mit den Augen rollen zu können und nicht die volle Wucht dieser Klischees, Vorurteile und Falschinformationen abzubekommen, ist mir aber erst durch dieses Buch klar geworden. Und ich denke hier bin ich nicht die einzige, die an genau dieser Stelle schon mehrfach unachtsam in die Falle getappt ist. Celsy Dehnert beschreibt es in ihrem Buch so passend:
„In einem industrialisierten Kapitalismus, der massengefertigte Produkte zu niedrigen Preisen auch unteren Einkommensschichten zugänglich macht, wurde Natürlichkeit zum angestrebten Ideal“ (S.151)
Ich nehme hieraus unter anderem mit, zukünftig Konserven, Tiefkühlware und Fertiggerichte viel selbstverständlicher in die Beratung oder das Coaching mit einzubauen. Was bisher schon immer klar war: es kommt immer darauf an, womit wir etwas vergleichen. Und Tiefkühlgemüse ist mit Sicherheit bedeutend gesundheitsfördernder als kein Gemüse. Außerdem kommt es stark darauf an, welches Fertiggericht man zu sich nimmt. Es ist so ein bisschen wie mit der Margarine. Während diese früher tatsächlich oftmals voller ungesunder Fette war, ist das inzwischen nicht mehr so. Die Industrie hat auf die Kritik (und die ausbleibenden Käufe) reagiert. Der schlechte Ruf bleibt teils hängen. So ist es auch bei den Fertigprodukten. Es gibt unfassbar schlechte, die wirklich voller Zutaten sind, die kein Mensch braucht. Aber es gibt eben auch welche, die gar nicht mal so schlecht sind.
Fazit
Das Buch strotzt nur so vor Denkanstößen – manche implizit, andere sehr explizit. Es kann sowohl im privaten, als auch im professionellen Kontext zu mehr Sensibilität anregen und genau deswegen habe ich mich auch entschieden es hier vorzustellen. Da dies ein Blog ist, der sich vor allem mit Essen und Entspannung beschäftigt, habe ich hier auch mein Augenmerk auf eben dieses Kapitel gelegt. Es geht aber um so viele weitere Themen und Lebensfelder, dass ich das Buch auch jeder anderen Person empfehlen würde. Wenn ich damit dein Interesse geweckt habe, kannst du das Buch „Das Gefühl von Armut“ beispielsweise bei Autorenwelt finden.